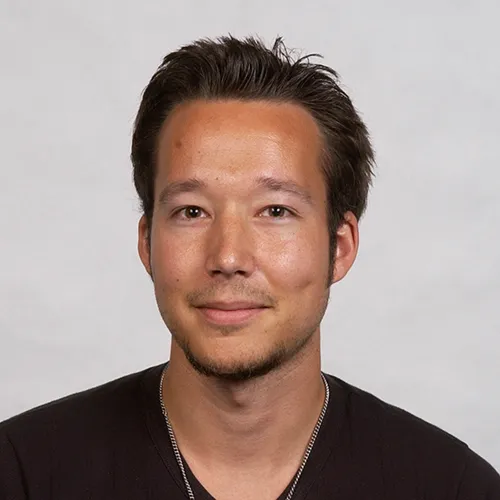Arbeit und soziale Integration
Die Integration von Personen mit einer Behinderung ist aus Sicht der Betroffenen wie auch aus gesellschaftspolitischer Sicht ein zentrales Anliegen. Dies wurde mit dem Beitritt der Schweiz zur UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2014 bekräftigt.
Ziel des Forschungsprogramms ist es, ein ganzheitliches Verständnis dafür zu gewinnen, wie gesundheitliche Einschränkungen im Zusammenspiel mit umwelt- und personenbezogenen Faktoren die gesellschaftliche Integration und Partizipation von Menschen mit einer Behinderung beeinflussen. Den konzeptionellen Rahmen bildet dabei die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF).
Mit unserer anwendungsorientierten Forschung versuchen wir insbesondere, die Voraussetzungen für eine nachhaltige Arbeitsintegration von Personen mit einer Querschnittlähmung zu identifizieren. Hierzu untersuchen wir, welche Einflussfaktoren dazu beitragen oder es erschweren, dass betroffene Personen zufrieden und gesund sein können und dass sie bis zu ihrer Pensionierung im Arbeitsprozess bleiben. Unsere Forschungserkenntnisse liefern so eine Datengrundlage für die Optimierung bestehender und die Entwicklung neuer Unterstützungsangebote für querschnittgelähmte Personen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen.

Forschungsprojekte
Berufliche Wiedereingliederung
In der Schweiz gehen etwas mehr als 50 % aller Personen mit einer Querschnittlähmung einer bezahlten Arbeit nach. Dies sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung rund 30 % weniger. Berufliche Wiedereingliederungsprogramme haben zum Ziel, die Betroffenen langfristig in eine befriedigende und sinnstiftende Tätigkeit zu integrieren und somit auch die Erwerbsquote von Personen mit einer Querschnittlähmung zu erhöhen. Dazu bedürfen sie eines umfassenden und fundierten Wissens über jene Faktoren, welche die Arbeitsreintegration der Betroffenen kurz-, mittel- und langfristig beeinflussen.
Basierend auf Daten der nationalen Kohortenstudie zu Querschnittlähmung (SwiSCI) und in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für berufliche Wiedereingliederung (ParaWork) am Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) führen wir Forschungsprojekte durch, um diejenigen Faktoren zu bestimmen, die eine langfristige und nachhaltige Arbeitsreintegration von Personen mit Querschnittlähmung begünstigen bzw. dafür hinderlich sind. Neben der Untersuchung unterschiedlicher Möglichkeiten zur Arbeitsreintegration widmen wir uns insbesondere der Frage, wie eine optimale Übereinstimmung zwischen Person und Job erreicht werden kann. Unser ultimatives Ziel ist es, Ansatzpunkte für Interventionen zu generieren, die auf eine nachhaltige berufliche Wiedereingliederung von Personen mit einer Querschnittlähmung ausgerichtet sind.
Nachhaltige Arbeitsmarktintegration
Das Wissen darüber, wie Menschen mit Behinderung nach einem Unfall oder einer Krankheit bei der Rückkehr zur Arbeit bestmöglich unterstützt werden können, hat in den letzten Jahren ständig zugenommen. Im Gegensatz dazu wissen wir noch wenig über die Faktoren, die es diesen Menschen nach Wiederaufnahme einer Arbeitstätigkeit ermöglichen oder sie daran hindern, zufrieden und gesund sowie dauerhaft bis zu Ihrer Pensionierung im Arbeitsprozess verbleiben zu können. Daten aus der nationalen Kohortenstudie zu Querschnittlähmung (SwiSCI) bestätigen internationale Beobachtungen, dass Menschen nach einer Rückenmarksverletzung im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung häufiger vorzeitig aus dem Arbeitsprozess ausscheiden.
Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass eine Rückenmarksverletzung nicht nur die unmittelbar anschliessende Rehabilitation erfordert, sondern auch ein lebenslanges Gesundheitsmanagement mit dem Ziel einer optimalen (Arbeits-) Partizipation.
Um eine optimale Arbeitspartizipation dauerhaft zu unterstützen, müssen wir die relevanten Einflussfaktoren und ihre Wirkungsweisen kennen und ihre Wechselwirkungen besser verstehen. Grundlegende Erkenntnisse dazu erhalten wir, indem wir berufliche Lebensverläufe betrachten und evaluieren.
Abklärungen zur Arbeitsfähigkeit
Abklärungen zur Arbeitsfähigkeit basieren auf medizinischen Gutachten. Sie bilden die Grundlage für die Entscheidung, ob eine bei der IV, der Suva oder einer Privatversicherung versicherte Person Anspruch auf ein Taggeld, eine Rente oder berufliche Reintegrationsmassnahmen hat. Um möglichst faire Entscheidungen zu ermöglichen, sollten medizinische Gutachten vergleichbare Einschätzungen zur Arbeitsfähigkeit liefern. Zudem sollten sie nachvollziehbar darstellen, wie ihre Einschätzung zustande gekommen ist.
Dies erfordert eine Abkehr vom lange Zeit vorherrschenden biomedizinischen und diagnoseorientierten Ansatz zugunsten eines biopsychosozialen Modells, das die arbeitsbezogene Funktionsfähigkeit einer Person ins Zentrum rückt. Eine funktionsbasierte und biopsychosozial ausgerichtete Begutachtung kann aufzeigen, wie behinderungsbedingte Einschränkungen und kontextuelle Faktoren auf Ebene Umwelt und Person die Fähigkeit einer Person beeinflussen, die Anforderungen einer konkreten Arbeitstätigkeit zu erfüllen. Auf Grundlage des ganzheitlichen biopsychosozialen Modells der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) widmen wir uns der Entwicklung funktionsbasierter Instrumente, welche die Standardisierung und Transparenz im Kontext von Arbeitsfähigkeitsabklärungen erhöhen.
Werden Sie jetzt Mitglied und erhalten Sie im Ernstfall 250 000 Franken.